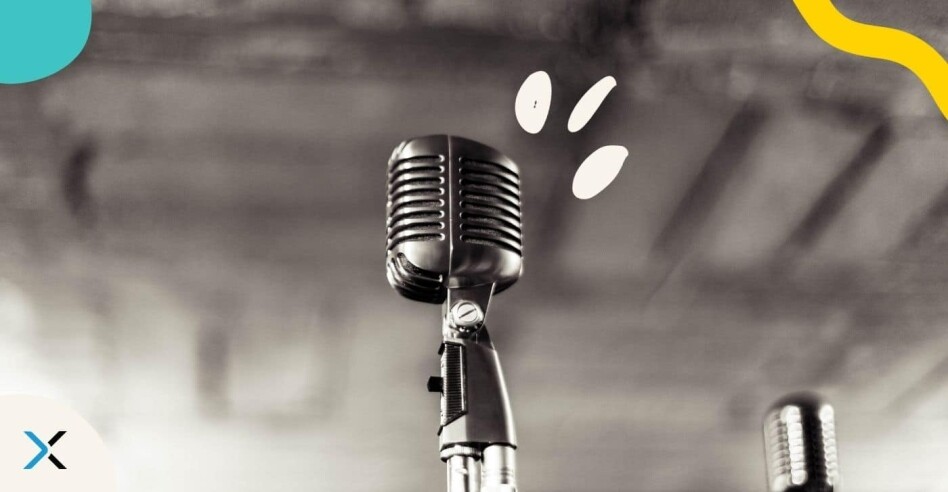
Die deutsche Sprache steckt voller sprachlicher Eigenheiten und Mehrdeutigkeiten, die selbst erfahrene Muttersprachler*innen ins Stolpern bringen können. Und wenn es dann auch noch darum geht, die Sprache in die schriftliche Form zu bringen …
Lassen Sie es uns so sagen: Jeder von uns hat schon mal einen Blogbeitrag oder eine Pressemitteilung gelesen, die nicht ganz gelungen war.
Ein Fehler, den Autor*innen besonders häufig machen, ist die Verwendung des Passivs statt des Aktivs. Doch was ist eigentlich das Aktiv? Und warum ist es oft besser geeignet als die passive Form? Lassen Sie uns das Ganze einmal genauer betrachten.
Die Grundlagen verstehen: Aktive und passive Form erklärt
Im Aktiv führt das Subjektnomen eine Handlung aus. Diese wird durch ein Verb ausgedrückt. Das Objekt empfängt die Handlung.
Stefan stößt Mark in den Pool.
In diesem Beispiel ist Stefan das Subjekt und Mark das direkte Objekt, d. h. das Ziel der Handlung.
In der passiven Form nimmt das direkte Objekt die Rolle des Subjekts ein:
Mark wird von Stefan in den Pool gestoßen.
Obwohl Mark nun das Subjekt des Satzes ist, tut er eigentlich nichts. Stattdessen lehnt er sich passiv zurück und empfängt die Handlung, in den Pool gestoßen zu werden.
Vielleicht fragen Sie sich: Sind Passivkonstruktionen falsch? Und sollten Sie auf das Passiv besser verzichten?
Grammatikalisch gesehen sind Passivkonstruktionen nicht falsch. Aktiv formulierte Sätze sind aber meist einfach spannender, lebendiger und prägnanter. Bei unseren Beispielsätzen fällt auf, dass der Passivsatz zwar die gleiche Geschichte erzählt, aber mit mehr Wörtern und weniger Schwung.
Wann sind Passivkonstruktionen in Ordnung?
Haben Sie auch in der Schule gelernt, das Passiv um jeden Preis zu vermeiden? So strikt müssen Sie natürlich nicht vorgehen. Es gibt sogar Situationen, in denen das Passiv dem Aktiv überlegen ist. Beispiele sind:
| Grund | Beispiel |
|---|---|
| Sie möchten die Aufmerksamkeit bewusst auf die Empfänger*innen der Handlung lenken – und nicht auf die Ausführenden. | „Der Kellner wurde in den Pool gestoßen.“ |
| Die Person, die die Handlung ausführt, ist unbekannt. Oder es ist für Ihre Aussage einfach irrelevant, sie zu erwähnen. | „Ein Cheeseburger wurde versehentlich in den Pool geworfen.“ |
| Sie wollen die Identifizierung der ausführenden Personen absichtlich vermeiden. | „Die Bußgelder für die Beschädigung des Pools werden am Montag eingezogen.“ |
Das Passiv wird auch regelmäßig in wissenschaftlichen Texten verwendet. Diese Praxis dient dazu, einen Fokus auf Vorgänge und Ergebnisse zu legen, anstatt auf die Forschenden. In der Belletristik wird es als Stilmittel verwendet, um Spannung aufzubauen oder Handlungen herunterzuspielen. Mittlerweile sind Passivkonstruktionen auch im Journalismus üblich. Wie in: „Es wurde uns von einer Reihe von Vorfällen berichtet, die sich am Pool des örtlichen Schwimmbads zugetragen haben.” Hier wird das Passiv genutzt, um die berichtende Person aus der Berichterstattung herauszuhalten.
Wann Sie mit Passivkonstruktionen sparsam umgehen sollten
Wir haben bereits angeschnitten, dass das Passiv schnell schwunglos und wortreich wirkt. Außerdem können die Verständlichkeit und Schnell-Lesbarkeit von Texten unter Passivkonstruktionen leiden. Stellen Sie sich z. B. ein Handbuch vor. Passivsätze, die nicht anzeigen, wer eine Handlung durchführt, verleiten zur Missinterpretation und damit im schlimmsten Fall zur Falschbedienung von Produkten. Außerdem stehen die vergleichsweise längeren Sätze dem Credo kurzer, einfacher Informationseinheiten im Wege.
Zusammenfassend: Sie müssen das Passiv nicht um jeden Preis meiden – aber nutzen Sie es mit Augenmaß.
Aktiv oder Passiv? Drei Tipps für lebendige Sätze
Die folgenden drei Tipps erleichtern Ihnen die Entscheidung zwischen der aktiven und passiven Form in Ihren Texten:
1. Schreiben Sie klar und deutlich
Denken Sie daran, dass unnötig lange Sätze das Lesen erschweren und einen Text schnell schlapp wirken lassen. Das wollen Sie beim Erstellen von Content für Ihre Kunden*innen unbedingt vermeiden? Es gibt außerdem keinen Grund, der für das Passiv spricht? Dann verwenden Sie nach Möglichkeit das Aktiv, um Ihren Content klar und prägnant zu gestalten.
2. Denken Sie an THZ: Thema, Handlung, Ziel
Gute Autor*innen überarbeiten ihren Text vor der Fertigstellung mehrfach. Denken Sie beim Feinschliff an das THZ-Prinzip – Thema, Handlung, Ziel. Stellen Sie beim Bearbeiten Ihres Textes sicher, dass alle drei Aspekte klar verständlich sind.
3. Verwenden Sie den „Zombies“-Test
Grübeln Sie beim Überarbeiten Ihrer Texte manchmal auch minutenlang, ob ein Satz jetzt eigentlich passiv oder aktiv formuliert ist? Dann ist der „Zombies“-Test eine gute Eselsbrücke für Sie. Moment. Was? Zombies? Sie haben richtig gelesen.
Das steckt dahinter: Wenn Sie nicht sicher sind, ob ein Satz im Aktiv oder Passiv steht, versuchen Sie „von Zombies“ hinzuzufügen. Der Satz ergibt Sinn? Dann handelt es sich um einen Passivsatz. Beispiel: „Das Poolwasser wurde (von Zombies) verschmutzt“ ist eine Passivkonstruktion. (Und wenn Sie beim Lesen aufmerksam waren, wissen Sie, dass er nicht der Wahrheit entspricht. Besagter Pool wurde eigentlich durch einen Cheeseburger verschmutzt.)
Mit diesem Trick können Sie Passivsätze leichter erkennen und überarbeiten, damit Ihr Content klar und ansprechend bleibt.
Passivkonstruktionen identifizieren: Gibt’s dafür auch Software?
Wir haben Ihnen Tipps zum Identifizieren und Überarbeiten von Passivkonstruktionen an die Hand gegeben, aber Hand aufs Herz: Wer Content erstellt und bearbeitet, denkt normalerweise nicht pausenlos an Grammatik.
Software kann diese Aufgabe übernehmen. So bleibt Autor*innen mehr Zeit für die Auseinandersetzung mit ihren Texten. Grammatik-Tools können Ihnen dabei helfen, Passivkonstruktionen in Ihrem Text zu identifizieren. So können Sie entscheiden, ob das Passiv seinen Zweck erfüllt oder ob Sie ihn lieber ins Aktiv umformulieren.
Sie erstellen Unternehmens-Content? Dann ziehen Sie am besten Content-Governance-Software wie Acrolinx in Betracht. Diese überprüft nicht nur Ihre Texte auf Passivkonstruktionen, sondern bringt viele Vorteile mit, auf die wir jetzt kurz eingehen.
Grammatik-Tools vs. Content-Governance-Software: Tipps für die Entscheidung
Grammatik-Checker sind eine gute Ergänzung im Alltag, aber für Unternehmens-Content sind noch viele weitere sprachliche Aspekte relevant. Content-Governance-Software wie Acrolinx:
- Prüft nicht nur auf Rechtschreibung und Grammatik, sondern auch auf Aspekte wie Terminologie, Ton, Stil, Einheitlichkeit, inklusive Sprache und Schnell-Lesbarkeit.
- Stellt sicher, dass unternehmensspezifische Sprachrichtlinien konsequent eingehalten werden. Grammatik-Tools lassen sich in der Regel nicht an Unternehmensspezifika anpassen.
- Sorgt für eine einheitliche Brand Voice in all Ihren Texten. Grammatik-Tools erlauben hingegen nicht die Prüfung von großen Content-Beständen.
- Hält Inhalte über verschiedene Zielgruppen, Märkte und Kanäle hinweg konsistent. Grammatik-Tools berücksichtigen keine kanal- oder zielgruppenspezifischen Anforderungen.
- Unterstützt die Qualitätssicherung und Zusammenarbeit in großen Teams und über Abteilungsgrenzen hinweg. Gängige Grammatik-Tools bieten keine Funktionen für teamübergreifende Workflows oder abgestimmte Freigabeprozesse.
Verbessern Sie Ihren Schreibstil: Halten Sie ihn klar, prägnant und aktiv
Aktivformulierungen sorgen für klare und direkte Sätze. Dennoch hat das Passiv in bestimmten Kontexten durchaus seinen Platz. Dazu gehören zum Beispiel wissenschaftliche Texte und formelle Berichte. Ein weiterer Anwendungsfall ist die Beschreibung von Situationen, in denen der Fokus auf dem Empfänger der Handlung liegt.
KI-basierte Content-Governance-Software wie Acrolinx hilft Ihnen dabei, Passivkonstruktionen in Ihren Texten aufzuspüren und – wenn gewünscht – umzuformulieren. Und zwar direkt in den Tools, in denen Sie Content erstellen.
So stellen Sie sicher, dass Ihr Content stets gut lesbar und verständlich ist und den Schreibregeln Ihres Unternehmens entspricht.
Sie wollen sich selbst ein Bild von Content-Governance-Software in Aktion machen? Vereinbaren Sie jetzt eine Demo und lernen Sie Acrolinx kennen.
Are you ready to create more content faster?
Schedule a demo to see how content governance and AI guardrails will drastically improve content quality, compliance, and efficiency.
Hannah Kaufhold
ist Senior Marketing Manager bei Acrolinx und verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung in den Bereichen Content-Strategie und Content-Erstellung sowie einen Master-Abschluss in Linguistik. Hannah interessiert sich für kontrollierte Sprachen und Terminologie und engagiert sich für Vielfalt und Inklusion. In der Freizeit verbringt Hannah gerne Zeit mit der Familie und liest leidenschaftlich gerne.