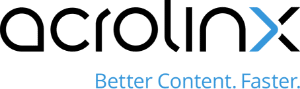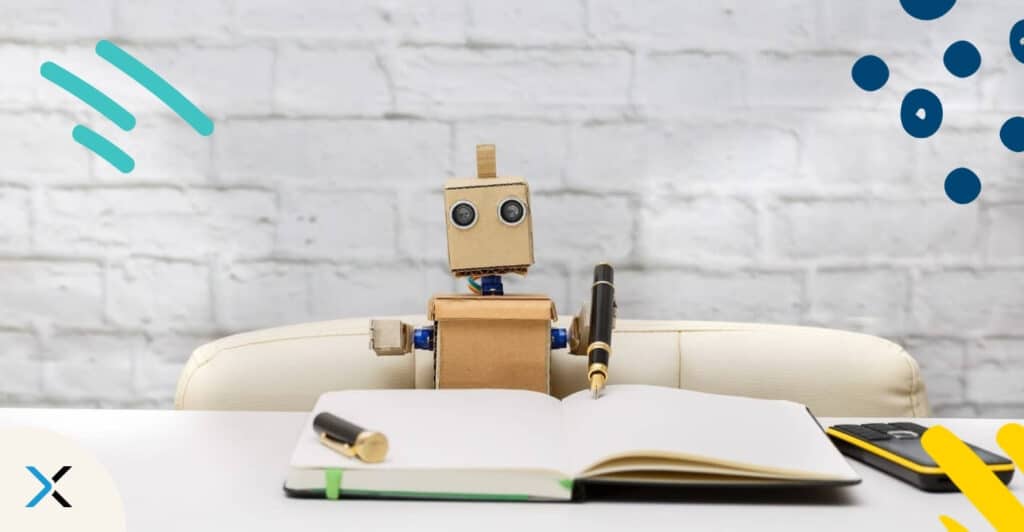In vielen Kommunikationskampagnen wird der Begriff „Künstliche Intelligenz“ (KI) zum Verkaufsanreiz. Doch was verbirgt sich wirklich hinter dem Versprechen „KI-basiert“?
Immer häufiger nutzen Unternehmen Begriffe wie „AI“, „maschinelles Lernen“ oder „intelligente Systeme“ – ohne dass diese Technologien eine zentrale Rolle in ihren Produkten oder Dienstleistungen spielen.
Hier erfahren Sie, wie Sie AI-Washing identifizieren können. Außerdem zeigen wir, welche negativen Folgen es für Kund*innen und Unternehmen haben kann.
AI-Washing – was bedeutet der Ausdruck?
AI-Washing beschreibt die Praxis, den Einsatz von Künstliche Intelligenz in Produkten, Dienstleistungen oder Geschäftsprozessen übertrieben oder gar falsch darzustellen. Es ist ein Marketingphänomen, das Vertrauen schaffen soll, wo keines gerechtfertigt ist. Damit ähnelt es dem Greenwashing im Nachhaltigkeitsbereich.
Unternehmen suggerieren etwa, dass ihre Lösungen auf echter Künstlicher Intelligenz basieren, obwohl es sich nur um regelbasierte Systeme oder einfache Automatisierungen handelt. Besonders in Bereichen wie IT, Marketing oder Kund*innenservice taucht das Problem immer häufiger auf. So werden beispielsweise manche Chatbots fälschlicherweise mit „AI-basiertem Kund*innendialog“ beworben, obwohl die Systeme lediglich vordefinierte Antworten auf Schlüsselbegriffe liefern – ohne jegliche Lernfähigkeit oder kontextbezogene Anpassung. Für Kund*innen, Geschäftspartner*innen und Investor*innen wird es dadurch zunehmend schwerer, echte KI-Innovationen von Marketing-Blendwerk zu unterscheiden.
Wie lässt sich AI-Washing erkennen?
AI-Washing lässt sich nicht immer auf den ersten Blick entlarven. Doch es gibt einige praktische Kriterien, die Ihnen dabei helfen können, unrealistische Aussagen über Künstliche Intelligenz besser einzuordnen:
1. Fehlende technische Details
Auf der Website eines Unternehmens steht viel über „AI“ und „automatisierte Prozesse“ – aber es gibt keine konkreten Informationen zu den verwendeten KI-Technologien oder Verfahren. Wenn Begriffe wie „Deep Learning“, „Natural Language Processing“ oder „maschinelles Lernen“ nur in allgemeinen Zusammenhängen auftauchen, ist Vorsicht geboten.
2. Keine erkennbare Rolle von KI im Produkt
Obwohl ein Produkt als „KI-basiert“ beworben wird, erfüllt es Funktionen, die sich auch ohne KI problemlos umsetzen lassen. Oft fehlt ein klarer Zusammenhang zwischen dem angeblichen KI-Einsatz und dem tatsächlichen Mehrwert für die Nutzer*innen.
3. Unklare Aussagen in der Kommunikation
Marketingbotschaften sprechen von „intelligenten Lösungen“, „neuartiger KI“ oder „Revolution im Arbeitsprozess“ – doch konkrete Anwendungen, Daten oder Ergebnisse fehlen. Der Begriff KI wird häufig inflationär verwendet. Unternehmen nutzen ihn, um ihr Image aufzuwerten. Dabei liefern sie oft keine Substanz.
4. Keine unabhängige Prüfung oder Zertifizierung
Bei echter KI-Innovation setzen viele Organisationen auf Nachvollziehbarkeit, dokumentierte Datenprozesse oder externe Audits. Wenn solche Maßnahmen fehlen, sollten Verbraucher*innen und Investor*innen skeptisch werden.
5. Der Hype steht im Mittelpunkt – nicht die Funktion
Wenn Unternehmen sich mehr auf den Hype um Künstliche Intelligenz konzentrieren als auf funktionierende Prozesse oder konkrete Herausforderungen, ist AI-Washing oft nicht weit. Besonders dann, wenn Unternehmen Begriffe wie „Artificial Intelligence“ vor allem als Schlagwort in Kommunikationskampagnen verwenden.
Warum AI-Washing nicht nur Kund*innen, sondern auch Unternehmen schadet
AI-Washing mag kurzfristig Aufmerksamkeit erzeugen, ist aber langfristig riskant – für Unternehmen ebenso wie für ihre Kund*innen. Die Glaubwürdigkeit einer Marke leidet massiv, wenn sich die Versprechen als übertrieben oder falsch herausstellen.
Solche Praktiken schädigen den Ruf der gesamten KI-Branche. Verbraucher*innen verlieren Vertrauen. Investor*innen hinterfragen KI-Projekte kritischer. Im schlimmsten Fall werden echte Innovationen im allgemeinen Hype untergraben.
AI-Washing ist nicht nur für Privatkund*innen zu einem echten Problem geworden. Nicht zuletzt führt es dazu, dass Unternehmen auf der Suche nach passenden KI-Lösungen falsche Entscheidungen treffen. Sie laufen somit in Gefahr, in Projekte zu investieren, die weder für interne Prozesse noch für die Kund*innenkommunikation einen nachhaltigen Mehrwert bringen.
Besonders in regulierten Bereichen können die Konsequenzen gravierend sein. Denken Sie beispielsweise an die Finanzbranche, das Gesundheitswesen oder die öffentliche Verwaltung. Wenn Unternehmen eine KI-basierte Lösung einführen, die im Ernstfall keine nachvollziehbaren oder geprüften Ergebnisse liefert, gefährden sie die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben und den Schutz sensibler Daten. AI-Washing kann also nicht nur Imageschäden, sondern auch rechtliche und wirtschaftliche Risiken nach sich ziehen.
Klare Sprache: Ein Mittel gegen unrealistische Erwartungen
Klare Sprache ist ein wirksames Mittel gegen AI-Washing, wenn Unternehmen über ihre KI-Lösungen kommunizieren. Vage Versprechen, übertriebene Buzzwords oder bewusst vage Aussagen lassen Kund*innen im Unklaren über die angebotenen Lösungen.
Umso wichtiger ist es, klare, präzise und realistische Sprache mit einer einheitlichen Terminologie zu verwenden. Sowohl in Marketingmaterialien als auch in Produktbeschreibungen, Pressemitteilungen oder auf der eigenen Website.
Eine kurze Checkliste für KI-Anbieter*innen
Beachten Sie die folgenden Schreibtipps, wenn Sie über Ihre KI-Lösungen schreiben:
- Erklären Sie verständlich, wie ihre Lösungen funktionieren. Nicht nur in technischen Dokumenten, sondern bereits auf Ihrer Website.
- Zeigen Sie Beispiele aus der Praxis. Je mehr konkrete Anwendungsfälle Sie aufzeigen, desto glaubwürdiger wird Ihr KI-Angebot.
- Verwenden Sie technische Begriffe korrekt und konsistent.
- Wecken Sie keine falschen Erwartungen.
- Seien Sie bereit, kritische Fragen transparent zu beantworten.
Kund*innen müssen nachvollziehen können, welche Funktionalitäten durch KI – insbesondere durch generative KI – unterstützt werden und welche Funktionen z. B. auf regelbasierte Ansätze zurückgreifen.
Generative KI – nur mit hochwertigem Input
Damit generative KI einen Mehrwert bietet, spielt die Qualität des Input-Contents eine zentrale Rolle. Generative KI liefert nur dann taugliche Ergebnisse, wenn sie mit hochwertigem, markenkonformen Content trainiert wird. Wenn Unternehmen ihre KI-Systeme mit unpräzisen oder übertriebenen Inhalten füttern, potenzieren sich die Fehler. Etwaige unrealistische Erwartungen an das Produkt verstärken sich weiter.
Hier setzt Acrolinx an: Mit Schreibregeln für alle Anwendungsfälle, digitalen Styleguides und Content-Leitplanken. Acrolinx sorgt dafür, dass alle Ihre veröffentlichten Inhalte Ihren unternehmenseigenen Schreibregeln und Anforderungen entsprechen.
Das System erkennt Formulierungen, die nicht den Unternehmensstandards entsprechen und unterbindet deren Veröffentlichung durch automatisierte Prüfprozesse. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass Ihre Kommunikation rechtskonform, markentreu und transparent bleibt. Und das nicht nur während des Schreibens, sondern auch während und nach der Veröffentlichung.
Das Resultat: Ein konsistenter, glaubwürdiger Außenauftritt, der Vertrauen schafft – und AI-Washing von Anfang an keine Chance gibt.
Mit Content-Governance von Acrolinx AI-Washing vermeiden
Der beste Weg, AI-Washing zu vermeiden? Klare, transparente Kommunikation – intern wie auch extern. Unternehmen, die Künstliche Intelligenz einführen möchten, sollten ehrlich darüber sprechen, was ihre KI-Lösungen leisten – und was nicht. Das schafft Vertrauen und schützt vor Missverständnissen.
Die automatisierte Content-Governance von Acrolinx sorgt dafür, dass Aussagen über KI – zum Beispiel auf Websites, in eBooks oder Produktbeschreibungen – konsistent, überprüfbar und verständlich sind. Dank automatisierter Prüfmechanismen und intelligenten, klickbaren Vorschlägen unterstützen wir Autor*innen dabei, klare Aussagen zu treffen, stilistische Standards einzuhalten und Missverständnisse zu vermeiden.
Gerade in einer Zeit, in der viele Firmen cloudbasierte KI-Dienste einführen und gleichzeitig Regularien erfüllen müssen, wird die Sprache zum entscheidenden Faktor. Acrolinx hilft dabei, echte KI von reiner Behauptung zu unterscheiden. Und das in jeder Phase der Kommunikation.
Sie möchten wissen, wie Ihre Inhalte mit Acrolinx klarer und vertrauenswürdiger werden? Dann werfen Sie einen Blick auf unsere Lösungen – und vermeiden Sie AI-Washing von Anfang an. Neugierig auf Acrolinx? Lassen Sie uns reden!
Are you ready to create more content faster?
Schedule a demo to see how content governance and AI guardrails will drastically improve content quality, compliance, and efficiency.

Hannah Kaufhold
ist Senior Marketing Manager bei Acrolinx und verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung in den Bereichen Content-Strategie und Content-Erstellung sowie einen Master-Abschluss in Linguistik. Hannah interessiert sich für kontrollierte Sprachen und Terminologie und engagiert sich für Vielfalt und Inklusion. In der Freizeit verbringt Hannah gerne Zeit mit der Familie und liest leidenschaftlich gerne.